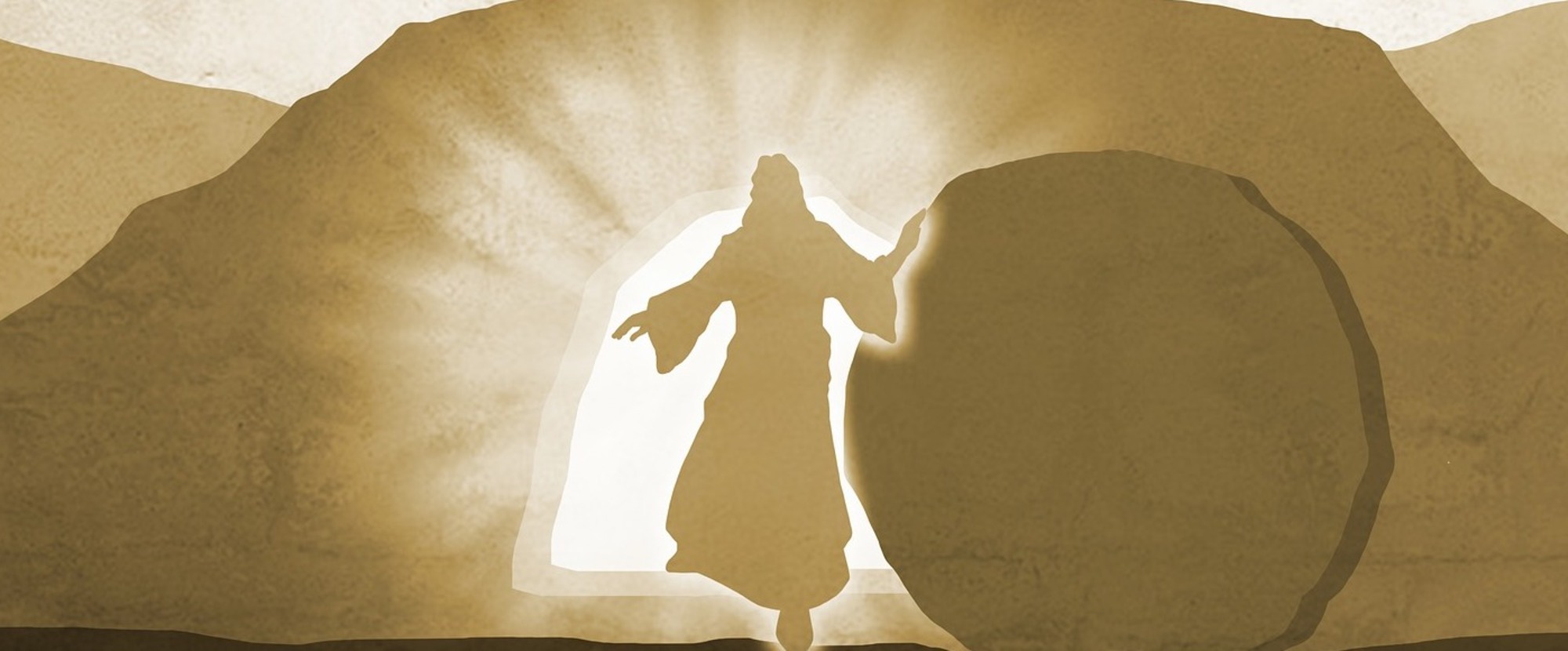
Während seines öffentlichen Wirkens und sogar nach seiner Kreuzigung sagte Jesus viele Interesse erweckende Sätze, die in den Ohren von jemandem, der behauptet, in Glaubensfragen „taub“ zu sein, eher seltsam klingen würden.
Einer dieser zahlreichen Sätze ist auch jener, den er laut dem Bericht im Johannesevangelium (Johannes 20,11-18), an Maria Magdalena richtete, als sie sein Grab besuchte. Er lautet: „No li me tangere!“ oder übersetzt: Halte mich nicht fest! (Rühre mich nicht an.) Eine sehr ungewöhnliche Aussage, fast eine Warnung, für jemanden, der sich wünschte, dass Er und die Menschen eins seien. Jetzt, dieses Mal, sucht er nicht die Nähe. Aber das ist nur auf den ersten Blick so. Was wollte Jesus mit diesen Worten eigentlich sagen?
Bedenken wir, dass Jesus nach der Auferstehung einen verherrlichten Körper hat. Dann begegnete ihm Maria Magdalena, und die Botschaft seiner Anwesenheit wird untrennbar mit seiner Anwesenheit unter den Jüngern verbunden. Der auferstandene Jesus gehörte ganz der Gemeinschaft, denn dies war eines der Ziele seines Todes und seiner Auferstehung, wenn man von Zielen sprechen kann. Unmittelbar nach ihrer Begegnung betraute er Maria mit der Aufgabe, den anderen Jüngern zu sagen, dass er „zum Vater gehe“. Es gibt da etwas in der Beziehung der Jünger wie zum Beispiel von Maria Magdalena und Petrus zu Jesus, die eine andere Nuance der Beziehung zu Jesus herstellten als die anderen Jünger, oder möchte uns das Evangelium das nur so vermitteln. Maria Magdalena und Petrus sind beide archetypische Gestalten von Augenzeugen, die in einem bestimmten Moment eine bestimmte Aufgabe von ihm „erhielten“. Petrus muss mit der Gründung der Gemeinschaft – der Kirche – beginnen, und Maria Magdalena erhält die Botschaft, auf der diese Kirche gegründet ist. Die Auferstehung Jesu löst eine gewisse schwer fassbare, aber allgegenwärtige Hoffnung, einen Glauben und eine Liebe unter den Jüngern aus, die nach Pfingsten vollkommen aufleben werden. Petrus und Maria Magdalena waren die Ersten, die diese Botschaft überbrachten, noch bevor der Heilige Geist auf die Jünger herabkam.
Wie sich Jesus im Moment ihres Treffens an Maria Magdalena wendete, sie ansprach, verweist bereits auf die vorgesehene Mission, die zu erfüllen ist. Diese Sendung ist auch unsere, denn was den Aposteln anvertraut wurde, ist auch uns anvertraut, im Einklang mit unseren Lebensumständen und der Art unserer Berufung. Jesus möchte nicht, dass die Jünger an seiner Gestalt und an seinen Werken vor der Auferstehung „hängen“, denn „die Geschichte ist noch nicht zu Ende.“ Durch sein Opfer am Kreuz und seine Auferstehung begann das erlösende Pasha-Opfer zu leben, von dem er wünscht, dass es für jeden Menschen Wirklichkeit wird. Er möchte, dass wir uns einer intensiveren Betrachtung seiner Anwesenheit in der Gemeinschaft – der Kirche – widmen. Das betrifft in erster Linie unsere Beziehungen: zueinander, zu uns selbst, zum Herrn. Nach der Auferstehung besuchte Jesus seine Jünger meist unerwartet. Jetzt war er hier und im nächsten Moment war er weg.
Oder er blieb ihnen unerkannt, bis er etwas sagte, was sie ihn vor der Auferstehung hatten sagen hören. Aber das wichtigste Zeichen der Wiedererkennung bei diesen unerwarteten Besuchen war und blieb die Eucharistie. Jesus hatte nicht die Absicht, seine Jünger zu erschrecken, als er nach der Auferstehung zu ihnen kam. Dafür hat er sozusagen gewisse Erkennungszeichen geschaffen. Wenn ihr auf dem Altar, in den Händen des Priesters Brot und Wein seht, dann bin Ich es. Jesus möchte, dass wir hier verweilen, uns hier aufhalten, und das Ziel ist unsere Auferstehung. Wenn wir in den Himmel kommen, empfangen wir keine Sakramente mehr. Wir haben im Laufe unseres Lebens alles bekommen, was wir bekommen konnten. Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht jenes Sakrament schauen, wegen dessen Liebe wir auf die Welt gekommen sind. Bis dahin müssen wir, vielleicht viele Male auch aufs Neue, unsere Mission neu entdecken ...
Foto: Pixabay
